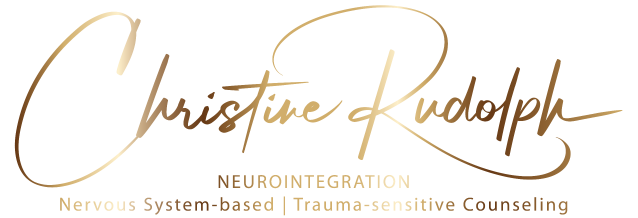Inhaltsverzeichnis
- Da, wo nichts mehr geht – das Phänomen psychische Ohnmacht
- Wenn der Körper abschaltet: Ohnmacht aus Sicht des Nervensystems
- Von frühen Prägungen und alten Mustern: Die unbewussten Wege in die Ohnmacht
- Unbewusste Ohnmacht: Hochfunktionalität als Schutz und Problem
- Ohnmacht als Nährboden für das Drama-Dreieck
- Kollektive Ohnmacht – wenn Systeme mächtiger sind als der Einzelne
- Wie komme ich raus, aus der Ohnmacht?
Ohnmacht ist nichts anderes als „Ohne Macht“ sein. Viele meiner Klienten kennen das Gefühl ganz genau, sie würden aber im ersten Moment nicht auf den Gedanken „Ohnmacht“ kommen.
Es ist das Gefühl, dass der Körper plötzlich leer läuft.
Dass man nichts mehr sagen oder entscheiden kann.
So, als würde man abtauchen oder durch eine Scheibe zusehen.
Die Worte fehlen, der Kontakt nach innen reißt ab.
Manche spüren einen Druck in der Brust, andere eine Leere im Kopf, Taubheit im Körper oder den plötzlichen Drang zu fliehen – oder einfach zu erstarren.
Im ersten Moment sieht niemand dahinter Ohnmacht. Es fühlt sich an wie Lähmung, wie ein Ausgesetztsein oder wie ein inneres „Wegsacken“. Manche beschreiben es, als wäre ein Teil von ihnen einfach ausgeschaltet. So, als hätte jemand kurzfristig das Steuer übernommen, und man selbst ist nur noch Zuschauer im eigenen Leben.
Erst, wenn ich das Wort „Ohnmacht“ ausspreche, kommt die Resonanz: „Ja, genau, ich habe keine Macht. Nichts mehr in der Hand. Ich bin einfach weg.“ Aber das eigentliche Gefühl, das erlebt wird – das läuft meist ohne dieses Wort und ohne Namen durch den Alltag. Oft mit Scham oder Selbstvorwürfen.
Und vielleicht lohnt sich an dieser Stelle ein kurzer Blick auf das Wort „Macht“ selbst. Macht ist im Inneren nichts Schlechtes. Es geht nicht um Kontrolle oder Überlegenheit, sondern um Gestaltungskraft – unsere Fähigkeit, Einfluss zu nehmen, Grenzen zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Unsere eigene Gestaltungsmacht im Leben wiederzufinden ist eine wichtige Ressource, um Ohnmacht zu überwinden.
Macht ist daher Energie, Richtung und Präsenz. Wenn sie fehlt, bleibt das Leben grau, bestimmbar und leer. Wenn wir sie wieder spüren – ganz unabhängig davon, was im Außen passiert – beginnt sich unser Erleben von Grund auf zu verändern.
Im Streit mit dem Partner: Keine Worte mehr. Gelähmt. Der Magen zieht sich zusammen, die Energie geht raus. Nicken, obwohl alles dagegen spricht. Im Büro, das Gespräch mit der Chefin: Jemand fühlt sich ganz klein, hat keine Stimme mehr, kann nichts mehr entscheiden, innerlich völlig abwesend, lange bevor das Meeting vorbei ist.
Auf der Familienfeier: Sechs Geschwister am Tisch, alle laut, alle sicher in ihrer Rolle. Der Jüngste sitzt daneben, wird permanent überhört. Jedes Mal, wenn er ansetzt, schneidet ihm jemand anderes das Wort ab oder spricht für ihn. Mit der Zeit hält er gar nicht mehr dagegen. Er sitzt zwar da, aber fühlt sich wie ausgebremst, nicht gemeint, unsichtbar. Das Gefühl, wieder einmal außen vor zu sein, kriecht langsam bis in die Haut.
Solche Situationen hinterlassen Spuren – nicht nur in dem einen Moment. Wer immer wieder übergangen wird, lernt, sich selbst zurückzunehmen. Wer spürt, dass die eigenen Worte nie ganz ankommen, wird irgendwann leise – nicht nur auf Familienfeiern, sondern auch im Alltag, im Job, in Beziehungen. Man funktioniert, passt sich an, macht alles „richtig“ – aber im Inneren bleibt dieses feine, kaum greifbare Gefühl: Hier habe ich nichts zu sagen. Hier komme ich nicht vor.
Das zieht sich wie ein unsichtbarer Faden durch das Leben. Es macht etwas mit dem Blick auf sich selbst. Mit dem Mut, sich zu zeigen oder etwas einzufordern. Und irgendwann erscheint es selbstverständlich, die Welt durch diesen Filter zu erleben – ohne zu ahnen, dass es auch anders sein könnte.
Viele halten das für Schwäche oder fragen sich, was mit ihnen nicht stimmt, während sie einfach nur weitermachen und funktionieren. Die Welt draußen läuft weiter, sie selbst sind innerlich stillgelegt. Als hätte jemand plötzlich den Stecker gezogen. Manche spüren es als tiefe Leere, andere wie einen unsichtbaren Käfig, in dem alle Kraft versackt. Es fehlt der Zugriff auf Worte, Mut und Handlung. Die Situation bestimmt, nicht mehr man selbst.
Oft ist das Gefühl nicht einmal richtig benannt. Es wird Scham daraus, Ärger auf sich selbst, Vermeidung. Oder immer mehr „machen“, um doch noch irgendwie Stimme zu bekommen. Ohnmacht ist selten Thema in Gesprächen – schon gar nicht im Job oder wenn es darum geht, „stark“ zu sein. Viele überspielen diese Erstarrung mit Leistung, Kontrolle, Anpassung. Und doch meldet sich das innere Wegsein immer dann, wenn etwas zu groß oder zu alt bekannt ist.
Was viele nicht wissen: Dieses Erstarren, Verstummen, Nicht-mehr-spüren kommt nicht von ungefähr. Das Nervensystem hat dafür Gründe – uralt, tief eintrainiert, oft übernommen aus Kindheit und Herkunftssystem. Ohnmacht ist nicht das Ende der Handlungsmacht, sondern ein Ergebnis. Und vielleicht auch ein Anfang.

Da, wo nichts mehr geht – das Phänomen psychische Ohnmacht
Psychische Ohnmacht: Was da passiert, ist schwer zu greifen – geschweige denn zu benennen. Viele Menschen kennen diesen Zustand oder dieses (mulmige) Gefühl, ohne ihn wirklich greifen zu können. Im Alltag taucht sie manchmal auf wie aus dem Nichts: Keine Energie mehr, keine Stimme, kein „Ich kann“. Was steckt eigentlich dahinter, wenn es psychisch „ohnmächtig“ wird?
Kurz erklärt: Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, Resignation – wo liegt der Unterschied?
Ohnmacht ist mehr als Hilflosigkeit. Hilflos zu sein bedeutet, in einem bestimmten Moment keinen Weg zu sehen, keine Lösung zu finden – aber Körper und Geist sind grundsätzlich noch handlungsbereit. Kontrollverlust fühlt sich so an, als überrollt Dich das Außen, als hätte jemand anders den Hebel in der Hand. Resignation ist das Aufgeben nach vielen erfolglosen Versuchen. Ohnmacht ist tiefer. Sie ist wie ein kollektiver Aus-Schalter von Handlung, Wille und manchmal sogar Fühlen. Das eigene System schaltet einfach auf „nicht mehr da“. Kein Zugriff mehr auf die eigene Kraft.
Was passiert im Körper, wenn Ohnmacht übernimmt? (Polyvagal betrachtet)
Ohnmacht ist aus Sicht der Polyvagal-Theorie (Dr. Stephen Porges) eine ganz spezifische körper-seelische Antwort auf überwältigenden Stress. Unser autonomes Nervensystem reagiert auf die Welt – und alles, was zu bedrohlich, zu viel oder zu alt vertraut an Überwältigung ist, lässt das System „abschalten“. Die Polyvagal-Theorie beschreibt diesen Zustand als Aktivierung des dorsalen Vagus: Das uralte „Totstellen-Programm“, tief verankert in unserem evolutionären Erbe.
Konkret heißt das: Der Körper fährt runter. Blutdruck sinkt, Magen zieht sich zusammen, Atmung wird flacher, manchmal verschwimmt alles. Die Muskeln verlieren Spannung oder gehen in Starre. Es fühlt sich an, als wäre innen alles auf stumm geschaltet – kein Zugang zu Impuls, Wort, Kraft. Gedanken driften ab, Erinnerungen werden vage, Zeit verliert an Bedeutung. Das geschieht nicht willentlich.
Das System schützt Dich auf diese Weise vor Überforderung: Wenn weder Flucht noch Kampf möglich scheinen, übernimmt der Shutdown. Aus der Traumasicht ist das oft die einzige Option, wenn das für Bewältigung notwendige Gegenüber, eine schützende Hand oder ein „Ausgang“ fehlt.
Warum bleibt Ohnmacht unsichtbar und tabuisiert?
Psychische Ohnmacht wird selten benannt und noch weniger verstanden. Im Alltag erscheint sie wie eine Schwäche oder als persönliches Versagen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ohnmacht entsteht, wenn das Nervensystem sich schützt, wenn Überwältigung im Raum steht – und zwar vollkommen unabhängig davon, wie „harmlos“ die Situation im Außen erscheinen mag.
In einer Gesellschaft, in der Kontrolle, Durchhalten und Selbstoptimierung zum Ideal gehören, hat Ohnmacht keinen Platz. Schnell wird das, was im Inneren als Überlebensermüdung, Erstarrung oder innerer Rückzug passiert, überdeckt durch Leistung, Perfektionismus, Tüchtigkeit. Kein Thema für den Smalltalk, sondern ein Tabu – und oft ein Grund für tiefe Scham.
Was viele nicht wissen: Diese Form von Ohnmacht ist kein individuelles Scheitern, sondern die intelligente Reaktion des Nervensystems aus der Erfahrung von Überforderung, Trauma oder alten, übernommenen Mustern. Sie ist ein Überlebensprinzip – und erzählt viel über das, was das System einmal schützen musste oder heute noch schützt.
Ohnmacht ist nicht einfach nur Wegsein, sondern ein Zustand, der nach einer anderen Sprache und einem anderen Verständnis ruft. Aus polyvagaler und traumasensitiver Sicht ist das oft der entscheidende Schlüssel, sich und das eigene Erleben wirklich zu verstehen – jenseits von Urteil und Scham.

Wenn der Körper abschaltet: Ohnmacht aus Sicht des Nervensystems
Um Ohnmacht wirklich zu begreifen, braucht es den Blick aufs Nervensystem – in das, was unterhalb unseres Bewusstseins geschieht. Die Polyvagal-Theorie hilft dabei, zu entschlüsseln, warum Menschen in bestimmten Situationen „einfach weg“ sind, innerlich abschalten oder emotional nicht mehr erreichbar wirken.
Ohnmacht oder Freeze? – Eine feine Unterscheidung
Das Gefühl von Ohnmacht ist subjektiv – das Erleben, gerade keinerlei Einfluss mehr zu haben. Im Körper kann sich das als sogenannter Freeze zeigen: Erstarrung, Spannung, wie festgehalten – äußerlich reglos, innerlich voller Alarm. Nicht immer aber ist Ohnmacht gleich Freeze – manchmal folgt darauf oder tritt direkt ein tiefes Wegsein (Shutdown) auf: völlige Leere, Abwesenheit, zurückgezogen in sich selbst. Manchmal wechseln die Zustände rasch oder vermischen sich sogar.
Ohnmacht ist das, was Du fühlst. Ob sich dahinter eher Freeze, Shutdown oder eine Mischung verbirgt, entscheidet dein Nervensystem „im Hintergrund“.
Ohnmacht
- Bedeutet: „Ich habe keinen Einfluss. Ich bin ausgeliefert. Ich kann nichts machen.“
- Bezieht sich auf das gesamte Erleben – auf Gedanken, Gefühle, Identität.
- Kann sich unterschiedlich äußern: als Freeze, als Shutdown, als Leere – aber auch als Verzweiflung, Resignation etc.
- Beispiel: „Ich habe das Gefühl, keine Chance zu haben.“ Oder: „Ich will reden, kann aber nicht, weil ich nichts in mir finde.“
Freeze
- Ist ein Modus, in den das Nervensystem als Schutz schaltet, wenn Gefahr oder Bedrohung zu groß erscheinen, Kampf oder Flucht aber nicht möglich sind.
- Da bist du in Dir selbst wie eingefroren: Der Körper ist angespannt, das System auf höchste Alarmbereitschaft, aber es passiert nichts mehr nach außen.
- Von außen: Regungslosigkeit, wie erstarrt. Innen: Stresspegel bleibt hoch! Es ist oft das Gefühl, innerlich festzuhängen, aber nicht handeln zu können.
- Beispiel: „Ich spüre einen Druck, bin ganz angespannt, kann mich aber nicht bewegen oder was sagen.“
Shutdown
- Bedeutet: „Ich bin ganz weg. Ich spüre kaum noch etwas. Alles scheint wie ausgeschaltet.“
- Bezieht sich vor allem auf den körperlichen und emotionalen Rückzug. Die Energie fährt komplett herunter, vieles ist taub, manchmal sogar der Körper selbst.
- Typisch ist das Gefühl von Leere, Abwesenheit, innerem Davonlaufen – nicht mehr Teil der Situation zu sein, sondern sich aus ihr in sich selbst zurückzuziehen.
- Beispiel: „Ich bin einfach nicht mehr da. Nichts dringt mehr richtig zu mir durch.“ Oder: „Ich nehme mich und meine Gefühle kaum noch wahr, alles ist grau und weit weg.“
In Kürze:
Ohnmacht: Das Gefühl, ausgeliefert zu sein – nichts geht mehr, ich habe keinen Einfluss auf das, was geschieht. „Ich habe nichts mehr in der Hand. Ich fühle mich ausgeliefert, wie abgeschnitten von meiner Kraft.“
Freeze: Ich bin wie erstarrt. Außen bewege ich mich kaum, innen bleibt alles starr und angespannt.
Shutdown: Plötzlich werde ich ganz leer, nehme mich selbst kaum noch wahr. Alles ist weit weg, dumpf oder betäubt.
Polyvagal-Theorie: Dorsaler Vagus, Freeze- und Shutdown-Zustände
Die Polyvagal-Theorie unterscheidet, vereinfacht gesagt, verschiedene „Zustände“ des Nervensystems. Solange Sicherheit da ist, funktioniert der sogenannte ventrale Vagus – wir spüren Kontakt, Neugier, soziale Verbindung. Kommt Stress oder Gefahr, schaltet sich zuerst der Sympathikus ein: Adrenalin, Herzrasen, der Körper bereitet sich auf Kampf oder Flucht vor.
Doch wenn das (Kampf oder Flucht) zu viel wird, zu bedrohlich, oder die Situation ausweglos erscheint, übernimmt ein anderer Teil: der dorsale Vagus. Das ist das, was im Tierreich als „Totstellreflex“ bekannt ist. Das System fährt herunter – sogenannte Freeze- oder Shutdown-Zustände entstehen. Diese uralte Reaktion hat das Überleben gesichert, wenn Kampf und Flucht unmöglich waren.
Biologische Funktion: Schutz und Überleben
Ohnmachtsreaktionen sind kein „Falsch-Sein“ sondern ein hochintelligentes Notfallprogramm. Die biochemischen Prozesse sorgen dafür, dass die Wahrnehmung gedämpft wird, Schmerz verringert wird, Handlungsfähigkeit eingefroren ist. In Situationen, in denen Gefahr als unerträglich groß erlebt wird, ist diese Erstarrung die einzige verbleibende Überlebensstrategie. Das Körpersystem schützt so Geist und Seele, bis die Gefahr vorüber ist.
Für das Nervensystem ist dieses Notfallprogramm ursprünglich eine wertvolle Überlebensstrategie. Doch bei manchen Menschen läuft dieses Muster nicht nur in Extremsituationen, sondern Tag für Tag – manchmal über Jahre oder Jahrzehnte. Das System bleibt quasi dauerhaft in diesem Schutzmodus hängen, selbst wenn im Außen keine akute Gefahr mehr besteht.
Das Problem daran: Ohnmachtsreaktionen sind dann nicht mehr nur kurzfristige Ausnahmen, sondern bestimmen das gesamte (Stresser)leben, prägen Beziehungen, Beruf, Selbstbild und Alltag. Menschen „funktionieren auf Sparflamme“. Es kostet enorme Kraft, im Überleben zu „leben“. Meistens aber bleibt dieses Notfallprogramm im Alltag unbemerkt – es fühlt sich einfach wie das normale Leben an. Viele merken gar nicht, dass das Nervensystem auf Daueralarm läuft, weil es schon so lange zum eigenen Erleben gehört.
Alarmiert oder abgeschaltet? Zwei Wege, wie unser Körper auf Stress antwortet
Wenn das Nervensystem Gefahr spürt, gibt es zwei typische Arten zu reagieren:
Sympathikus:
Das ist unser innerer Turbo. Hier schaltet der Körper auf Alarm, macht sich bereit für Kampf oder Flucht. Das Herz schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an, vielleicht gibt es feuchte Hände, das Denken rast – alles steht auf „jetzt los!“. Typisches Beispiel: Jemand erschrickt, steht sofort unter Spannung, will diskutieren oder am liebsten davonrennen.
Dorsaler Vagus:
Wenn Kampf oder Flucht nicht (mehr) möglich erscheinen, zieht das System die Notbremse. Der Körper fährt runter, als ob jemand den Stecker zieht: Die Energie sackt ab, Magen und Kopf werden dumpf, manchmal fühlt man sich entfernt, wie betäubt oder leer. Nichts geht mehr – es ist das klassische „Totstellreflex“-Programm aus der Biologie.
Kurz gesagt:
Sympathikus bedeutet: Alles wird mobilisiert, der Körper steht unter Strom.
Dorsaler Vagus bedeutet: Der Körper macht dicht, zieht sich innerlich zurück und schaltet auf Sparflamme.
So schützt uns das Nervensystem – entweder durch Aktivität (Angriff/Flucht) oder durch Rückzug (Erstarrung/Abtauchen).
Wie der Körper Ohnmacht erlebt: Erstarrung, Taubheit, Dissoziation, Leere
Die Körperspuren von Ohnmacht sind oft subtil, manchmal aber auch ganz klar:
- Plötzliche Kälte oder Taubheit in den Gliedmaßen
- Muskulatur erschlafft oder wird hart und unbeweglich
- Körperhaltung fällt in sich zusammen oder friert ein
- Magen zieht sich zusammen, Herzschlag wird kaum noch wahrgenommen
- Atmung wird flach, manchmal fast „unsichtbar“
- Die Sinne stumpfen ab, Geräusche und Stimmen dringen nicht mehr richtig durch
- Der Geist ist leer, Gedanken brechen ab, es entsteht eine Art Nebel
Menschen erleben eine emotionale Leere, als „wäre niemand mehr zuhause“. Die Gefühle sind abgeschaltet, alles läuft nur noch automatisiert. Dissoziation – das Gefühl, nicht mehr im eigenen Körper zu sein, sich nur noch als Beobachter wahrzunehmen – ist ein klassisches Zeichen für dieses Schutzprogramm.
Das sind sichtbare und spürbare Spuren eines Nervensystems, das Überleben sichern will – auch wenn die Gefahr heute vielleicht viel subtiler daherkommt (der Chef/der Partner) als damals in der kindlichen Ohnmacht oder in den Geschichten unserer Vorfahren.
Verstehen, wie der Körper diese Sprache spricht, ist der erste Schritt, alte Ohnmacht zu entmachten.

Von frühen Prägungen und alten Mustern: Die unbewussten Wege in die Ohnmacht
Ohnmacht ist kein Charakterzug, sondern eine Reaktion, die gelernt, geprägt und manchmal sogar systematisch antrainiert wurde – meist lange bevor sie ins eigene Bewusstsein rückt.
Kindheitliche Prägung und Biografie
Die ersten Erfahrungen mit Ohnmacht machen Menschen schon in der frühen Kindheit. Unsichere Bindungen, unberechenbare, abwesende oder übermächtige Bezugspersonen – all das prägt das Nervensystem. Wenn das Kind nicht zuverlässig gehalten, gespiegelt, verstanden wird, lernt es: Es gibt Situationen, in denen kein Einfluss mehr möglich ist. Es gibt Erwachsene, bei denen keine Reaktion mehr hilft. Aus dieser Erfahrung wächst im System das Muster: „Ich kann nichts tun. Ich habe keine Macht.“ Ohnmacht verankert sich als Überlebensstrategie im gesamten Organismus.
Kontrollverlust wird dabei nicht nur in akuten Bedrohungen gelernt, sondern oft in den kleinen Momenten des Alltags: Niemand hört zu. Meine Grenzen werden übergangen. Gefühle sind unerwünscht oder werden lächerlich gemacht.
Je weniger Raum für eigene Impulse und Bedürfnisse, desto mehr lernt das kindliche System Anpassung, Erstarrung, Rückzug. Wenn Bindung zum Preis der Selbstaufgabe stattfindet, bleibt Ohnmacht als unausgesprochene, dauerpräsente Ahnung im Hintergrund.
Gesellschaftliche Programmierung: Gehorsam, Autorität und kollektive Angst
Ohnmacht kommt nicht nur aus dem Elternhaus. Sie ist auch etwas, das gesellschaftlich tief eingebettet ist. Eltern, Großeltern, ganze Familien haben dieses Gefühl oft schon übernommen – nicht, weil sie „schuld“ sind, sondern weil auch sie es von früher, aus ihren Systemen, erlebt und weitergetragen haben.
Es ist wie ein Kreis, der sich immer weiter dreht: Die Muster von Ohnmacht und Ausgeliefertsein entstehen nicht einfach nur im Privaten, sondern werden auch aus Gesellschaft, Geschichte und kollektiven Ängsten weitergegeben – und oft unbeabsichtigt an die nächste Generation vererbt.
Wer zum Beispiel in Deutschland lebt, lernt früh: Folgen zählt mehr als eigenes Spüren. Gehorsam, Anpassung, Autorität und die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, werden oft höher bewertet als eigene Kraft und Ausdruck. Schule, Arbeitsplatz, viele Familien – überall funktionieren Hierarchien. Wer zu laut, zu emotional, zu rebellisch wird, landet schnell am Rand. Kollektive Angst, ausgegrenzt zu werden, hält viele in Schach.
Das führt dazu, dass viele Menschen Ohnmacht gar nicht mehr als Ausnahme empfinden, sondern als Normalzustand. Entscheidungen werden an „die da oben“ abgegeben, Verantwortung delegiert. Die eigene Stimme wird leise. Das Nervensystem speichert ab: Es ist sicherer, stillzuhalten als aufzumucken. Die Spuren dieser kollektiven Ohnmacht finden sich später nicht nur im eigenen Erleben, sondern in gesellschaftlichen Dynamiken, in Politik, Arbeit, sogar Spiritualität.
Transgenerationale Perspektive: Weitergabe von Ohnmachts- und Opfernarrativen
Ohnmacht wirkt über Generationen. Viele Glaubenssätze, Ängste und Narrative sind vererbt: „So ist das eben. Da kann man nichts machen.“ Gerade im Kontext von Trauma zeigt sich in der therapeutischen Arbeit: Was Eltern und Großeltern nicht verändern konnten, wird unbewusst weitergegeben – als Haltung, als Körperhaltung, als Glaubenssatz, als Schweigen.
Familien sind geprägt von Geschichten, in denen Ohnmacht die zentrale Rolle spielt – Kriege, Flucht, Verlust von Heimat oder Sicherheit. Das wird selten besprochen, aber fast immer gefühlt. Die loyalen Bindungen führen dazu, dass wir selbst dann noch Ohnmacht reproduzieren, wenn wir längst erwachsen und frei wären. Diese Narrative wirken tief, vor allem an den Stellen, wo sie nicht gesehen und bearbeitet werden.
Die Summe aus individueller Erfahrung, familiärer Prägung und gesellschaftlicher Struktur ergibt das, was viele als Ohnmacht im Inneren tragen: ein zutiefst menschliches, aber lange nicht bewusstes Muster. Wer die Herkunft versteht, kann beginnen, Freiheit im Nervensystem und neuen Handlungsspielraum zu erfahren.
Unbewusste Ohnmacht: Hochfunktionalität als Schutz und Problem
Ohnmacht hat nicht immer das offensichtliche Gesicht von Rückzug oder Passivität. Besonders bei Menschen, die als „stark“, „verlässlich“ oder „leistungsfähig“ gelten, ist sie gut getarnt – hinter Kontrolle, Perfektion und scheinbarer Unerschütterlichkeit. Das System funktioniert, oft jahrelang. Hochfunktionalität wird dann selbst zur Überlebensstrategie: Wer immer alles im Griff hat, liefert und organisiert, ist meist nicht einfach nur „stark“, sondern schützt sich. Ohnmacht wird überspielt durch Leistung, Effizienz, hohe Ansprüche an sich selbst und den inneren Antrieb, nie Schwäche zu zeigen.
Dieses Muster schützt – solange es gebraucht wird. Wer funktioniert, spürt die eigene Verletzlichkeit oder Machtlosigkeit weniger. Aber der Preis dafür ist hoch – und wird selten gesehen.
Die stillen Folgen verdeckter Ohnmacht
Ohnmacht zeigt sich durch die Hintertür:
- Überanpassung: Es wird getan, was andere erwarten, Bedürfnisse werden hintenangestellt, ein ständiges Ja, selbst wenn das Innere Nein schreit.
- Selbstaufgabe: Eigene Wünsche, Kreativität, Leichtigkeit werden geopfert, damit das System weiterlaufen kann.
- Chronische Dissoziation: Vieles fühlt sich wie „durch eine Glasscheibe“ an, der Körper ist oft nicht wirklich spürbar, Gefühle scheinen gedimmt oder weit weg.
- Stille Wut (Passiv-aggessiv): Nach außen Ruhe und Kontrolle, innen angestaute Energie, Gereiztheit, Groll – alles nicht ausdrücklich gelebt, sondern nach innen gerichtet.
Körperlich zeigt sich das nicht selten durch Spannungen, Erschöpfung oder unerklärliche Schmerzen. Die eigentliche emotionale Not bleibt aber oft verborgen.
Warum Hochleistung häufig mit innerer Ohnmacht einhergeht
Das Paradoxe: Wer viel leistet, tut das häufig aus dem Versuch heraus, der eigenen Ohnmacht zu entkommen – nicht selten sogar unbewusst. Die Aktivität, das Funktionieren, ist eine Abwehr gegen das Gefühl, in Wahrheit nichts steuern zu können. Das Nervensystem bleibt chronisch im Überlebensmodus, mal überdreht (Sympathikus), mal erstarrt (dorsaler Vagus, s. Polyvagal-Theorie). Wo Ohnmacht nicht gefühlt werden darf, wird sie durch ständiges Tun ersetzt.
Das System funktioniert – bis es nicht mehr funktioniert. Ohnmacht wird solange nach außen kompensiert, bis sie sich ihren Weg nach innen bahnt: als Depression, Burnout, Erschöpfung, Zusammenbruch. Wer beginnt, die eigene Hochfunktionalität als Schutzmechanismus zu begreifen, entdeckt oft erst später die darunterliegende Ohnmacht. Erst dann entsteht Raum für eine andere, lebendigere Form von Macht – die, die aus Kontakt und echten, gelebten Grenzen entsteht.

Ohnmacht als Nährboden für das Drama-Dreieck
Das Karpman Drama-Dreieck beschreibt ein generelles Beziehungsmuster, egal ob mit Partnern, Geschäftspartnern, Freunden. Drei Rollen stehen dabei im Mittelpunkt: Opfer, Täter (bzw. Verfolger) und Retter. Es sind alte Muster, tief verankert im Nervensystem und fast immer verknüpft mit Ohnmachtsgefühlen.
Niemand steigt bewusst in dieses Rollenspiel ein. Diese Dynamik läuft meist ganz automatisch ab – wie ein eintrainiertes Muster, das oft schon in der Kindheit angelegt wurde. Viele kennen es, schon als Kind mehr oder weniger gezwungenermaßen in eine bestimmte Rolle geschlüpft zu sein: der Brave, der „Schwierige“, der Helfer, die Unauffällige. Was damals Überleben oder Anpassung gesichert hat, wiederholt sich später oft im Erwachsenenleben – ohne dass wir es bemerken oder wollen.
Im Drama-Dreieck fühlt sich das „Opfer“ machtlos, ausgeliefert, hilflos – unfähig, selbst Einfluss zu nehmen oder für sich zu sorgen. Der „Täter“ setzt Grenzen, fordert heraus oder übt Druck aus, gefühlt (oder tatsächlich) übermächtig, manchmal kalt. Der „Retter“ versucht einzugreifen, zu lösen, zu helfen, springt in die Bresche, oft ungefragt und aus eigenem Unbehagen mit den Gefühlen der Ohnmacht der anderen.
Diese Rollen sind nicht starr. Innerhalb einer einzelnen Situation oder Beziehung können sie wechseln – heute Opfer, morgen Retter, übermorgen gefühlt Täter.
Wie Ohnmacht sich als Opferrolle manifestiert
Die Ohnmacht findet im Drama-Dreieck ihr Zuhause in der Opferrolle. Hier verschwindet die Erfahrung von Handlungsfähigkeit. Die Welt ist zu groß, der vermeintliche Gegner zu mächtig, das eigene System zu klein. Die innere Haltung: „Ich kann ja eh nichts ausrichten“, „andere bestimmen über mich“, „es ist besser, sich rauszuziehen“. Die Macht wird nach Außen gegeben – an Personen, Systeme, Umstände. Häufig verbunden mit Hoffnung auf einen Retter oder Schuldzuweisungen an den (gefühlten) Täter.
Wechselwirkungen und emotionale Fallen
Das Drama-Dreieck wiederholt sich oft unbewusst in Beziehungen, Familien und Teams. Wer als Kind Ohnmacht und Ausgeliefertsein erfahren hat, „lernt“ automatisch die Opferposition. Später taucht sie überall da auf, wo Überforderung, Machtverlust und alte Gefühle getriggert werden. Der Wechsel zwischen Täter, Opfer und Retter ist dabei fast unausweichlich:
- Das Opfer wird plötzlich zum Angreifer, weil es sich verteidigen muss.
- Der Retter kippt ins Opfer, wenn seine Hilfe abgelehnt wird.
- Der Täter fühlt sich womöglich missverstanden und gleitet selbst ins Opferempfinden.
Jede Rolle hat eine eigene emotionale Falle: Das Opfer fühlt sich klein und ohne Einfluss, verlernt eigene Möglichkeiten zu sehen. Der Retter hält eigene Angst oder Ohnmacht nicht aus. Der Täter kanalisiert ungelebte Verletzungen als Kontrolle oder Angriff.
Praxisbeispiel: Wie Ohnmacht Beziehungen prägt
Ein typisches Bild: In einer Partnerschaft schweigt einer immer häufiger, zieht sich zurück (Opfer), weil Streit als bedrohlich empfunden wird. Der andere übt Druck aus, fordert Klärung (Täter), fühlt sich selbst aber eigentlich verzweifelt und überfordert. Ein dritter im Umfeld – zum Beispiel die beste Freundin (Retter) – springt ein, versucht zu vermitteln, zu schlichten, zu „retten“. Niemand verlässt dieses Dreieck gestärkt – weil die eigentliche Ohnmacht nicht verarbeitet, sondern über Bande ausgespielt wird. Handlungsfähigkeit, echte Begegnung und Selbstverantwortung bleiben auf der Strecke.
Erst das Bewusstwerden der eigenen Rolle(n) im Drama-Dreieck – und der darunterliegenden Ohnmacht – öffnet einen Weg hin zu echter Veränderung, zu neuen Erlebensräumen jenseits von Kampf, Rückzug und ungewolltem Helfen.
Praxisbeispiel: Das Drama-Dreieck im Unternehmen
Auch im Arbeitsalltag läuft das Drama-Dreieck oft unsichtbar mit – eingebettet in Strukturen, Teams und Hierarchien. Zum Beispiel: Ein Mitarbeiter fühlt sich vom Chef übergangen und vielleicht sogar ungerecht behandelt. Das Ohnmachtsgefühl wächst: „Ich kann eh nichts ausrichten, meine Meinung zählt nicht.“ Es entsteht die Opferrolle.
Die Chefetage wird so – ob sie will oder nicht – zum „Täter“ stilisiert: die Entscheider, die Druck ausüben, Forderungen stellen oder Veränderungen ankündigen. Für viele der scheinbar übermächtige, unnahbare Teil des Systems.
Häufig wird dann die Hoffnung auf Rettung in das Unternehmen selbst, die Personalabteilung, einen Betriebsrat oder auf „die nächste Führungsebene“ projiziert. „Die werden das schon regeln, die holen uns da raus.“ Auch Kollegen können in die Retterrolle schlüpfen, wenn sie den Konflikt für den/die Betroffene:n ansprechen, vermitteln oder sich „an die Front stellen“.
Doch so wird die Verantwortung von einer Ebene zur nächsten weitergeschoben, statt dass gemeinsam an einer Lösung gearbeitet wird. Niemand kommt wirklich in Kontakt mit seiner eigenen (Mit-)Verantwortung. Ohnmachtsgefühle und die Rollenmuster setzen sich fort – und drehen ihre Runden, bis jemand erkennt, was da eigentlich auf unsichtbarer Ebene gespielt wird.
Kollektive Ohnmacht – wenn Systeme mächtiger sind als der Einzelne
Ohnmacht ist nicht nur ein individuelles Empfinden. Sie ist Teil ganzer Systeme. Gesellschaften und Kulturen haben ihre eigenen Formen von Ohnmacht – und eigene Mechanismen, sie zu festigen. Das zeigt sich in kleinen Situationen des Alltags, aber auch in übergeordneten Strukturen wie Patriarchat, Politik, Arbeitswelt.
Strukturelle und systemische Ohnmachtsgefühle
Die Erfahrung, wenig bis keinen Einfluss zu haben, zieht sich durch gesellschaftliche Institutionen. In hierarchischen Strukturen (Arbeitswelt, Schule, Verwaltung) wird Entscheidungsmacht nach oben delegiert. Wer mitreden will, steht oft vor verschlossenen Türen. Politik erscheint für viele so weit weg, dass eigene Belange kaum berührt werden. Gesetze werden gesetzt, Macht verteilt – das Gefühl „Ich kann eh nichts ändern“ ist alltäglich.
Patriarchale Ordnungen, die auf Autorität und Kontrolle gebaut sind, produzieren systemisch Ohnmachtsdynamiken – insbesondere für alle, die nicht ins dominante Raster passen. So wird Ohnmacht von Generation zu Generation weitertransportiert, oft subtil, in Form von Regeln, Erwartungen oder schlicht durch fehlende legitime Einflussmöglichkeiten.
Wie gesellschaftliche Systeme Ohnmacht stabilisieren
Ohnmacht bleibt nicht zufällig bestehen. Gesellschaften arbeiten mit Werkzeugen, die sie absichern:
Schuld und Scham werden gezielt eingesetzt oder in Kauf genommen. Wer Fehler macht, abweicht, oder einfach „anders“ ist, wird beschämt, ausgeschlossen und lächerlich gemacht. Wer zu laut wird, wird sanktioniert, isoliert oder entwertet. Die Botschaft ist subtil, aber klar: Du hast nur bedingt Macht über Dein Leben – und wehe, Du gefährdest das System durch Abweichung.
Leistung und Anpassung werden mit Zugehörigkeit belohnt, Schwäche und Zweifel oft mit Abwertung bestraft. Wer als „schwierig“ gilt oder nicht funktioniert, wird an den Rand gedrängt. So bleibt Ohnmacht im System und im eigenen Körper allgegenwärtig, selbst wenn sie nicht offen ausgesprochen wird.
Die Macht der Ohnmacht – wie Medien Angst und Passivität füttern
Auch Medien, Popkultur und Werbung transportieren immer wieder Geschichten von Ohnmacht:
Der einzelne als ohnmächtiges Opfer großer Verhältnisse, als Konsument von Katastrophen, als passiver Teil einer nicht beeinflussbaren Welt. Social Media zeigt Übermacht, Schönheits- und Erfolgsideale, die für die meisten unerreichbar bleiben. Nachrichten kreisen um Bedrohung, Angst und Scheitern. „Große Heldengeschichten“ gehören Wenigen – für den Rest bleibt oft nur die Zuschauerrolle.
Diese allgegenwärtigen Narrative prägen die eigene innere Haltung: Lieber klein, lieber angepasst, lieber resigniert als aus der Masse auszuscheren und Verantwortung, Mitgestaltung oder Protest sichtbar zu machen.
Kollektive Ohnmacht ist also kein Zufallsprodukt. Sie hat Struktur, Geschichte und Funktion. Wer das erkennt, muss nicht länger stillhalten: Das Verstehen gesellschaftlicher Ohnmachtsmuster ist ein erster Schritt, eigene Handlungsräume zu entdecken – auch, wenn sie sich anfangs klein anfühlen.

Wie komme ich raus, aus der Ohnmacht?
Ohnmacht ist kein Schicksal. Und es gibt keinen „Trick“, mit dem sie von heute auf morgen verschwindet. Was sich oft über Jahre im Körper, im Nervensystem und in Beziehungen verfestigt hat, braucht mehr als bloß guten Willen oder eine einzelne Methode. Es ist ein Weg, der an mehreren Stellen beginnt und sich Schritt für Schritt entfaltet.
Für echten Wandel braucht es aus meiner Sicht immer beides:
Den Körper rausführen aus der Starre und das eigene Erleben von Ohnmacht – diese alten Geschichten, Überzeugungen und Rollen – bewusst ins Licht holen. Anders gesagt: Es reicht nicht, nur am Symptom zu schrauben, wenn innerlich das alte Muster weiterläuft. Und umgekehrt: Gedankliche Veränderungen bleiben oft blass, wenn der Körper weiterhin alles wie früher speichert.
Es gibt dabei verschiedene Ebenen, die zusammengehören:
Körperliche und seelische Selbstregulation – wie Ohnmacht sich auflösen kann
Regulation heißt, das eigene System wieder in die Hand zu nehmen – sanft, behutsam, ohne Druck. Der polyvagale Ansatz betrachtet dabei zuerst den Körper: Atem spüren, den Raum wahrnehmen, sich orientieren. Mikro-Momente der Selbstwirksamkeit entstehen da, wo ich mich entscheide: für einen bewussten Atemzug, eine Mini-Bewegung, das Fokussieren auf einen sicheren Punkt im Außen. Das sind keine großen Wundertaten, sondern kleine Schritte zurück in die Präsenz. Das Nervensystem lernt: Ich bin nicht mehr ausgeliefert, ich kann Einfluss nehmen – auch, wenn’s erstmal nur ganz wenig ist.
Trauma- und Bindungsarbeit als Basis für Autonomie und Selbstermächtigung
Der wirkliche Wandel entsteht nicht über guten Vorsatz, sondern durch Integration alter Erfahrungen. Trauma- und Bindungsarbeit zeigt, wo Ohnmacht ihren Ursprung hat – und was gebraucht wird, um sie zu lösen. Es geht nicht darum, „die Vergangenheit zu vergessen“, sondern das eigene System (wieder) in sichere Erfahrungen zu führen: Gesehen werden, gehalten sein, Bindung fühlen, ohne Kontrolle zu verlieren. Über Körpertherapie, EMDR, Polyvagal-Übungen oder traumasensitives Yoga öffnen sich Räume, in denen statt Automatik wieder Entscheidungskraft wächst. Das alte Muster kann überschrieben werden.
Systemischer Shift: Vom Opfer- zum Gestalterbewusstsein
Wirkliche Selbstermächtigung heißt nicht, nie wieder Ohnmacht zu spüren. Sie bedeutet, zu wissen: Ich habe Wahlmöglichkeiten, auch da, wo früher keine waren. Das ist ein innerer Wechsel vom Opfer- in ein Gestalterbewusstsein. Die eigene Macht ist keine, die über andere hinweggeht – sondern die, die aus Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen, Grenzen und Impulsen entsteht. Es geht darum, Verantwortung für die eigenen Reaktionen zu übernehmen und neue Antworten zu finden. Nicht für alles. Aber Schritt für Schritt für das, was möglich ist.
Community, Zugehörigkeit und Co-Regulation
Nervensysteme regulieren sich gemeinsam. Sichere, wohlwollende Beziehungen, liebe Menschen, vielleicht ein felliger Begleiter an der Seite, echte Zugehörigkeit, ein Kreis von Menschen, bei denen Masken nicht nötig sind – das sind heilsame Gegengifte gegen die Ohnmachtserfahrung. Co-Regulation, das absichtslose Miteinander, der geteilte Blick oder das offene Gespräch, bringen unser System in Sicherheit. In der Gemeinschaft können neue Erfahrungen entstehen: Nicht mehr alleine, nicht mehr ausgeliefert, sondern getragen und gesehen.
Aus all dem kann eine neue Form von Macht entstehen – nicht als Kampf, sondern als zurückgewonnene innere Autorität. Schrittweise und mit einem anderen Blick auf sich selbst und die Welt.
Ich begleite Dich gerne auf dem Weg heraus aus der gefühlten Ohnmacht. Bitte bedenke: Es ist kein Sprint, sondern ein Prozess, der meist Zeit, Geduld und innere Bereitschaft braucht. Ohnmacht entsteht oft über viele Jahre – entsprechend dürfen auch die Veränderungen wachsen, ihre eigene Geschwindigkeit haben und sich Schicht für Schicht zeigen.
Gerade bei tieferen Themen, bei alten Traumamustern oder familiären Verstrickungen, braucht es ein echtes Commitment zu diesem Prozess. Einzelne Sitzungen können wertvolle Impulse geben – für nachhaltige, tiefgehende Veränderung aber braucht es Bereitschaft, sich auf den eigenen Weg einzulassen und immer wieder hinzuschauen.
Wenn Du Dir diesen Weg für Dich vorstellen kannst, unterstütze ich Dich gerne mit all meiner Erfahrung und meinem fachlichen wie persönlichen Blick auf das, was Dich aus der Ohnmacht zurück in Verbindung und Selbstwirksamkeit bringen kann.
Der Start in diesen Prozess ist bei mir immer eine erste Counseling-Session. Das ist mehr als ein Kennenlerngespräch: Wir nehmen uns gemeinsam Zeit für eine gründliche Anamnese, Dein Anliegen, Deine Geschichte und auch für erste Impulse, mit denen Du unmittelbar etwas anfangen kannst. Nach der Session bekommst Du eine fundierte Dokumentation für Dich. So hast Du vom ersten Moment an echten Mehrwert – und gewinnst Klarheit darüber, wie der weitere Weg aussehen könnte.
Mir ist Transparenz wichtig: Der Einstieg ist bei mir immer verbindlich – eine erste Session, in der Du wirklich etwas mitnimmst, ganz ohne versteckte Kosten. Wir gehen diesen Schritt bewusst. Und Du kannst nach der ersten Session ganz in Ruhe entscheiden, ob und wie es für Dich weitergehen darf.
Hier geht´s zur Buchung der ersten Session.
Ich freue mich auf Dich.